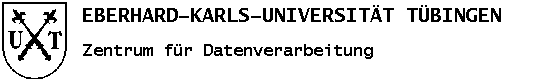
Protokoll des 16. Kolloquiums über die Anwendung der
Elektronischen Datenverarbeitung in den Geisteswissenschaften
an der Universität Tübingen vom 25. November 1978
Allgemeine Information
Die Tübinger Standard-Programme sind an den Universitäts-Rechenzentren in Konstanz, Marburg, Würzburg und am Leibniz-Rechenzentrum in München installiert und stehen dort den Benutzern zur Verfügung.Tübinger Beiträge zum Fachinformationssystem Geisteswissenschaften
Gunther Franz (Universitätsbibliothek)
Das Projekt THEODOK - Theologisches Informations- und Dokumentationssystem an der UB Tübingen
1. Sondersammelgebiet Theologie und bisherige InformationstätigkeitIm Rahmen des Sondersammelgebietsplanes der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) betreut die UB Tübingen den überregionalen Sammelschwerpunkt Theologie. Die Erwerbungstätigkeit erfolgt ohne Beschränkung durch Konfessions- und Ländergrenzen und hat die UB Tübingen in den letzten Jahren nach dem Erwerbungsvolumen wahrscheinlich zur größten theologischen Bibliothek der Welt neben der Library of Congress in Washington werden lassen. Um die Forschung auf die vorhandenen Ressourcen aufmerksam zu machen, veröffentlicht die UB Tübingen mit Unterstützung der DFG laufend sich gegenseitig ergänzende Informationsdienste.
- Mitteilungen und Neuerwerbungen.
Seit 1973, monatlich, für Monographien. Ab 1979 ist die Herstellung mit EDV und Beifügung alphabetischer Register in Zusammenarbeit mit dem ZDV geplant. - Zeitschrifteninhaltsdienst Theologie / Indices Theologici.
Seit 1975, monatlich. Current-Awareness-Dienst von 400 Zeitschriften, dazu Festschriften und Sammelwerken. Bibelstellen-, Personen- und Autorenregister in Verbindung mit dem ZDV. - Zeitschriftenverzeichnis Theologie.
1. Ausgabe 1977. Als erstem fachlichem Verzeichnis der Berliner Zeitschriftendatenbank kommt diesem Verzeichnis eine Pilot-Funktion zu.
Außerdem hat die seit 1967 erscheinende "Internationale Oekumenische Bibliographie" (IOB) ihre Redaktion 1978 von Genf an die UB Tübingen verlegt, da hier die zu verzeichnende Literatur am vollständigsten vorhanden sei. Für die Herstellung (Register und Druck) der von der DFG geförderten Bände 1973-75 und 1976-78 leistet das ZDV technische Hilfe. Die IOB soll in dem Projekt THEODOK aufgehen.
2. Das IuD-Programm der Bundesregierung
Die Sacherschließung soll mit Hilfe des "Programms der Bundesregierung zur Förderung der Information und Dokumentation" (IuD-Programm) intensiv in Angriff genommen werden. Alle Wissensgebiete sind in 16 Fachinformationssysteme (FIS) eingeteilt. Das FIS 14 Geisteswissenschaften besteht aus 6 Fachgruppen, darunter
- Philosophie, Theologie und Religionswissenschaft,
- Sprachwissenschaft (einschl. Germanistik).
3. Das Projekt THEODOK
Das Projekt THEODOK soll in den literaturintensiven Fachgebieten Theologie und allgemeine Religionswissenschaft zu einer grundlegenden Verbesserung der Literaturinformation im Hinblick auf Aktualität, Erschließungstiefe und Umfang der Berichterstattung führen. Durch die Verbindung mit dem Sondersammelgebiet Theologie ergibt sich die Chance, die bedauerliche Auseinanderentwicklung von Bibliothekswesen und Dokumentation zu überwinden. Vorteile sind:
- Alle zu erschließenden Dokumente sind im Informationszentrum vorhanden und können auf Grund von Autopsie bearbeitet werden.
- Die Auswahl, Erwerbung und Katalogisierung der Monographien kann als Eigenleistung eingebracht werden. Die Katalogisierung soll 1979 im Verbund der wissenschaftlichen Bibliotheken des Landes Baden-Württemberg auf EDV umgestellt werden.
- Alle angezeigten Titel sind - von unbedeutenden Ausnahmen abgesehen - schnell im Deutschen Leihverkehr im Original oder als Kopie erhältlich.
Zunächst sollen Jahresbände einer Theologischen Bibliographie mit systematischer Anordnung, erläuternden Anmerkungen und Schlagworten (aber ohne Inhaltsreferate) und Registern mit kombinierten Schlagworten erscheinen. Später kann auf Zwei-Monats- oder Quartalshefte unter teilweiser Einbeziehung der Informationsdienste der Theologischen Abteilung übergegangen werden. Da bei dem großen Umfang gedruckte Mehrjahreskumulationen zu aufwendig wurden, ist für später die Ausgabe der gesamten Literaturdokumentation auf COM-Mikrofiches vorgesehen. Das kann personal-intensive Karteien an zahlreichen Bibliotheken und Instituten ersetzen. Außerdem soll, wie erwähnt, Retrievalmöglichkeit im Dialogverkehr mit FIZ 14 bestehen. Der dafür notwendige Thesaurus soll auf dem Weg über kontrollierte Schlagwortlisten aufgebaut werden. Das Gesamtziel ist nur stufenweise zu realisieren. Die 1. Stufe umfaßt die Bearbeitung von Jahresbänden der Theologischen Bibliographie, Abteilung A: Allgemeine Religionswissenschaft, Theologie (Allgemeines), Systematische Theologie, Ökumene, und Abt. T: Theologiegeschichte, mit Monographien und Aufsätzen aus Zeitschriften und Sammelwerken. Die Erfassung der Rezensionen soll später folgen. Bei den geplanten komplexen Programmen zur Herstellung der Bibliographie und Register ist die Bereitschaft des ZDV zum Einsatz seiner vorhandenen zahlreichen Standardprogramme im Baukastensystem eine wesentliche Voraussetzung zum Gelingen. Katalogisierung der theologischen Literatur, Herstellung der Informationsdienste und der im Rahmen von THEODOK erstellten Bibliographien sowie der Magnetbänder für die Datenbank erfolgen also jeweils mit demselben Partner. Wenn die endgültige Bewilligung rechtzeitig vorliegt, soll im April 1979 mit der Arbeit von THEODOK begonnen werden.
Diskussion
Als Erscheinungstermin für den ersten gedruckten Jahresband ist 1980 vorgesehen. Die Katalogisierung wird nach dem Neuen Konstanzer Datenformat (NKD) erfolgen, das mit MAB1 kompatibel ist. Es werden die neuen "Regeln für die alphabetische Katalogisierung" (RAK) angewandt.Die Erstellung von Abstracts ist vorläufig nicht vorgesehen, da dies bei der großen Zahl der erscheinenden theologischen Titel für das Gesamtprojekt nicht durchführbar wäre. Die Ermittlung der Schlagwörter erfolgt manuell durch den zuständigen Bearbeiter. Die Anwendung eines automatischen Indexierungsverfahrens erscheint für dieses Projekt in der Theologie nicht möglich.
Die GERMANISTIK. Herstellung eines bibliographischen und Referateorgans mit Hilfe von EDV
Tilman Krömer (Redaktion GERMANISTIK)
Beschreibung von Produkt und Arbeitsabläufen
1. Das ProduktDie Zeitschrift soll rasch und umfassend über die Neuerscheinungen des Faches informieren: bibliographisch (selbständig und unselbständig erscheinende Publikationen) und mit kritischen Kurzreferaten (selbständig erscheinende Publikationen). Die Vervielfachung der Menge (jetzt ca. 8000 Titel-Nummern jährlich) bei gleichbleibender Personalkapazität und die steigenden Kosten von Satz und Druck machten Rationalisierungen zwingend. Die Umstellung auf EDV und Lichtsatz ist vollzogen.
Das Produkt sollte (zunächst) sein bisheriges Erscheinungsbild behalten; Gliederung der Vierteljahreshefte in große Sachgruppen, z.T. untergliedert nach Sachen bzw. Epochen bzw. (alphabetisch) einzelnen Dichtern, auf der untersten Ebene nach dem Alphabet der Verfasser (bei einzelnen Dichtern jedoch deren eigene Werke vor der Forschungsliteratur). Weitere Erschließung durch Verweisungen (jeweils nur mit der laufenden Titelnummer, z.T. zusätzlichen Stichwörtern); jährliches Namensregister, das durch Kursivdruck der betr. Nummern die Namen als Gegenstände von den Autoren unterscheidet. Ein Sachregister soll künftig geboten werden (bisher ein gewisser Ersatz in "Verweisnestern", besonders in den sachbestimmten Abteilungen). All dies, inclusive Typographie, Kolumnentitel, Zwischenüberschriften etc., wird nun automatisch erreicht, was freilich entsprechende Vorbereitung des Materials bereits bei der Erfassung erfordert.
2. Arbeitsvorgänge in der Redaktion
Bisher wurde jeder Titel für sich und vollständig auf einer Manuskriptkarte erfaßt, diese nach Vorlage korrigiert, die Karten wurden handsortiert, Leitkarten mit Überschriften sowie die Referate einsortiert, das Ganze durchnumeriert, die Verweise herausgezogen und geschrieben. Nach dem Satz in der Druckerei erfolgte mindestens ein (weiterer) Korekturgang, dann der Druck.
Nun werden die unselbständigen Titel am Terminal erfaßt, Zitiertitel der Quellen automatisch eingespielt; selbständige Titel (ca. 1/5 der Gesamtmenge) werden noch auf Manuskriptkarten erfaßt, dann - wie die Referate - über OCR. Ein Fehlerprüfprogramm läuft über alle Titel; Korrektur nach den Vorlagen. Sortierung, Verweiserzeugung, Registerherstellung werden maschinell bewerkstelligt.
3. Arbeitsersparnis
Erfassung am Terminal rascher und bequemer als mit Karten
an der Schreibmaschine, komfortable Korrektur-,
Ergänzungs- und Austauschmöglichkeiten; nur ein
Korrekturgang ist nötig; Sortierung, Verweis- und
Registerherstellung und Satzaufbereitung durch die Maschine;
Weiterverwendbarkeit der Daten.
Zu 1.:
Zu 2.:
Zu 3.:
Nur zur Datenprüfung wurde eine eignens FORTRAN-Programm
geschrieben, alle anderen Schritte sind mit den
Standard-Textprogrammen (TUSTEP) verwirklicht worden.
Als Erfassungsformat ist ein bibliothekarisches,
MAB1-kompatibles Format, das Neue Konstanzer Datenformat
(NKD) vorgesehen. Damit soll die Verknüpfung mit der
alphabetischen Katalogisierung der Fachbereichsbibliothek
und dem geplanten Katalogisierungsverbund der
Bibliotheken des Landes sowie die Übernahme von Titeln der
Deutschen Bibliographie ermöglicht werden. Diese Vorteile
überwiegen den Nachteil, daß in manchen Fällen der Umfang
der bibliographischen Beschreibung einer Titelaufnahme
für Bibliothekskataloge knapper als der einer Titelaufnahme
für das Referateorgan GERMANISTIK ist, so daß manche
Titel je nach Verwendungszweck in der
Katalogisierungsdatenbank in unterschiedlicher Form
abgespeichert werden müssen. Die unselbständige Literatur
(Aufsätze aus Zeitschriften und Sammelwerken) wird in einer
Textdatei, aber mit den gleichen MAB1-kompatiblen
Kategorienbeziehungen erfaßt werden.
Für das Projekt muß eine flexibel auswertbare Feinsystematik
entwickelt werden, die es erlaubt, umfangreiche Datenmengen
in großen Kumulationsstufen differenziert anzubieten, die
aber zugleich die Zusammenfassung von kleinen Datenmengen
in großen Sachgruppen für die Vierteljahreshefte der
GERMANISTK ermöglicht. Die systematische Notation wird
6-stellig sein, wobei die einzelnen Notationen jeweils
durch Sachbegriffe erweitert werden können.
Für die verschiedenen Informationsdienste (Referateorgan
GERMANISTIK, vierteljährlicher aktueller Informationsdienst,
der zu Jahres- und Fünfjahresausgaben kumuliert wird) sind
umfangreiche Programmpakete zu entwickeln, die im
wesentlichen folgende Leistungen erbringen müssen:
Es wird vorgeschlagen, ein Erfassungsformat zu konzipieren,
das in verschiedenen Richtungen auswertbar ist und so die
Nachteile der Abhängigkeit der verschiedenen
Eingabeformate von KOBAS (Konstanzer
Bibliotheks-Automatisierungs-System) und GERMANISTIK
vermeiden würde. Die Überführung von einem Format ins
andere ist häufig mit Informationsverlust verbunden; oder es
ist umgekehrt eine Anreicherung der Daten notwendig.
Es ist nicht vorgesehen, Abstracts anzufertigen. Der
erforderliche Aufwand läßt sich mit dem vorgesehenen
Personal nicht bewältigen.
Hannelore Ott (Firma pagina)
Die Herstellung des Referateorgans GERMANISTIK
Die Herstellung des Referateorgans "Germanistik" geht
in vier Schritten vor sich:
Alle selbständigen (Monographien) und
unselbständigen (Aufsätze) Titel werden in der Form:
[¦ rn 0001 ¦ n{]
erfaßt, wobei nur
die nicht geklammerten Teile notwendig für die Titelaufnahme
einer Monographie sind. Bei Artikeln aus Zeitschriften
bzw. Sammelbänden wird in der Form �s Sammelband bzw. �z
Zeitschrift die Quelle genannt und in der Titelaufnahme
anstelle der bibliographischen Angaben nach "In: S." die
Seitennummer des jeweiligen Artikels aufgeführt. Alle
unselbständigen Titel werden am Terminal erfaßt, die
selbständigen, zu denen Referate vorliegen, und die
Referate selbst auf OCR. Durch ein Programm werden die
formale Richtigkeit und die Angaben zur Klassifikation der
einzelnen Titel geprüft. Das Ergebnis der Prüfung ist so
gestaltet, daß es ein zeitsparendes Korrekturlesen ermöglicht.
(�s Sammelband) bzw. (�z Zeitschrift)
�2350 Dichter
[Autor, Vorname; [Autor2, Vorname]]: Titel
[Untertitel].- Bibliogr. Angaben� (bzw. In: S. 111-119�)
[Registereintrag 1; Registereintrag 2�]
[!!1709 (Zusatz) !!2750 Dichter !!1707]�
Die korrigierten Titelaufnahmen werden nun
automatisch um Zeichen ergänzt, die für die Sortierung
noch erforderlich sind; die Zeitschriften- bzw.
Sammelband-Titel werden bei den einzelnen unselbständigen
Titeln an den Stellen eingefügt, die durch "In:" markiert
sind. Die Sortierung der Titel erfolgt nach folgenden
Gesichtspunkten:
Der nach Titeln sortierten Reihenfolge wird dann die
Titelnummer vergeben, unter der der Titel in der GERMANISTIK
erscheint. Die Verweise (!!1702 usw.), die jetzt noch an
den Stellen stehen, auf die sie verweisen sollen, werden nun
von den Titeln getrennt; dabei wird jedem Verweis die
Titelnummer des Titels beigegeben, bei dem er stand,
also die Titelnummer, auf die er später verweisen soll.
In einer weiteren Sortierung werden diese Verweise an ihre
endgültige Stelle zwischen die Titel einsortiert. Zur
Aufbereitung für die automatische Satzherstellung werden
jetzt die durch einen numerischen Schlüssel erfaßten
Klassifikationen in die endgültigen Überschriften überführt,
die Kolumnentitel erzeugt, die Kursivierungen,
Verweispfeile und Einrückungen vorgenommen.
Jetzt fehlen nur noch die Referate. Titel, zu denen
ein Referat vorliegt, und das jeweilige Referat werden bei
der Erfassung mit einer eindeutigen Referatenummer ¦ rn
0001 ¦ n{ versehen. Die Referate werden (sobald sie
vorliegen und redigiert sind) automatisch gesetzt und den
Autoren zur Korrektur vorgelegt. Wenn sie jetzt anhand ihrer
Referatenummer zwischen Titel und Verweisen einsortiert
werden sollen, sind sie, was den späteren Satz betrifft,
fertig (incl. Silbentrennung), so daß sich als vierter
Schritt die weitere automatische Verarbeitung über die
Satzprogramme anschließen kann.
Diskussion
Die Erstellung von Registern für Einzelhefte der
GERMANISTIK ist möglich. Die Frage, warum dies nicht
geschieht, müßte an den Verlag gerichtet werden,
die Redaktion.
Valentin Schweiger (Fachbereichsbibliothek Neuphilologie)
Projekt-Planung GERDOK (Germanistische Dokumentation)
Das Projekt soll als Teilkomponente in das
Fachinformationssystem Geisteswissenschaften (FIS 14)
eingebracht werden. Ziel ist die Verbesserung des
Informationsangebots auf dem Gebiet der Germanistik
mittels Einsatz der EDV und durch eine verbesserte
inhaltliche Erschließung der Dokumentationseinheiten durch
Deskriptorenvergabe. Das Projekt soll in einer
Arbeitsgemeinschaft von Fachbereichsbibliothek und Redaktion
des seit 1960 erscheinenden Referateorgans GERMANISTIK
realisiert werden. Eine enge Zusammenarbeit mit anderen
Bibliotheks- und Dokumentationsstellen zwecks Datentausch
und Vermeidung von Doppelarbeit bei der Erfassung ist
geplant. Die elektronisch gespeicherten Daten ermöglichen
Informations- und Dokumentationsdienste auf verschiedenen
Anwendungsbereichen:
Ein erster Schritt ist bereits getan worden mit der
Umstellung der GERMANISTIK auf EDV-Herstellung, worüber
Herr Krömer und Frau Ott berichtet haben. Von GERDOK
geplant ist ein weiterer gedruckter Dienst, der das
Material aktuell (vierteljährlich), umfassend (auf
Vollständigkeit zielend) und gut erschlossen (durch eine
Feinsystematik und kumulierende Register) anbieten soll.
Jahres- und Fünfjahreskumulationen werden die Benutzung erleichtern.
Zur effizienten Literaturdokumentation gehört der
Standortnachweis der Literatur für den Benutzer. Während
beim THEODOK-Projekt die Sondersammelgebietsbibliothek und
die theologische Dokumentationsstelle identisch sind,
soll bei den GERDOK-Daten für beliebige Anwender der
Standortnachweis durch die Verknüpfung mit Standardadressen
(ISSN, ISBN, ID-Nummern nationaler, regionaler und lokaler
Datenpools) hergestellt werden.
Möglich sind sowohl retrospektive Recherchen als auch
SDI-Dienste. Da FIS 14 noch nicht gegründet ist und bisher
kaum Erfahrungen im Bereich der Geisteswissenschaften
vorliegen, lassen sich noch keine näheren Angaben über die
Marktchancen, die Kosten, den Kundenkreis usw. machen.
Die Datenerfassung wird mittels intelligenter Terminals oder im
Dialogbetrieb am Bildschirm erfolgen.
Diskussion
Die geplante Feinklassifizierung bringt die Gefahr der
Vereinheitlichung mit sich. Das Vorverständnis, das in der
Klassifikation enthalten ist, kann sich z.B. nachteilig
auf die Information über neue Ansätze in der Forschung oder
über Interpretationsnuancen auswirken.
(Die Kurzfassungen der Referate wurden von den Referenten
zur Verfügung gestellt.)
Zur
Übersicht über die bisherigen Kolloquien
tustep@zdv.uni-tuebingen.de - Stand: 17. April 2002