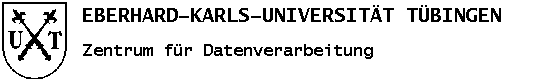
Protokoll des 28. Kolloquiums über die Anwendung der
Elektronischen Datenverarbeitung in den Geisteswissenschaften
an der Universität Tübingen vom 25. Juni 1983
Das Philologische Seminar Tübingen baut eine Sammlung
von Diapositiven (Dias) auf, deren Erfassung und
Katalogisierung mit EDV geschieht. Bis jetzt wurden ca.
1200 Dias aufgenommen; geplant ist ein Umfang von ca. 3000
Dias. Die Sammlung ist auf einen repräsentativen
Querschnitt des Materials zur klassischen Antike hin
angelegt, repräsentativ in zeitlicher (Gesamtzeitraum
der griechisch-römischen Antike), räumlicher
(Mittelmeerraum und angrenzende Gebiete) und sachlicher
Hinsicht (Kunst, Topographie und materielle Kultur
gleichrangig). Der Zugang zum Material erfolgt über
ausgedruckte Listen, die den Benutzern zur Verfügung
stehen. Die Listen verbinden eine relativ ausführliche
Beschreibung des Bildinhalts mit der Möglichkeit eines
nach Sachthemen differenzierten Zugriffs, wobei die
Handhabbarkeit und nicht die wissenschaftliche
Vollständigkeit der Beschreibung im Vordergrund stehen.
Die Sammlung und die Listen dienen den Bedürfnissen der
Didaktik (Vorbereitung von Exkursionen, Vorlesungen und
Referaten) im Philologischen Seminar, das keinen
direkten Zugang zum Diaschrank bieten kann.
Die Sammlung wird zur Zeit von zwei Hilfskräften mit
minimaler Stundenzahl betreut. Die eine Hilfskraft ist für
photographische Arbeiten und Ausleihe zuständig, die
andere für Computerarbeiten.
Um die Aufbereitung zu erleichtern, wurde ein
Auftragsblatt entworfen, in das vom Auftraggeber die
Grundinformationen über den Bildinhalt einzutragen
sind. Die Auftragsblätter bilden die Grundlage der EDV-Erfassung.
Die einzelnen Dias werden nach folgenden Rubriken aufgenommen:
Die übrigen Rubriken enthalten weitgehend frei
formulierbare Angaben, wobei die Literatur-Nachweise in
den Rubriken 6 und 7 nach einem festen Schema
erfolgen. Auch die Angaben zur Datierung in Rubrik 5
sind weitgehend normiert, um eine chronologische
Sortierung zu ermöglichen. Die frei formulierbaren
Rubriken werden durch KWIC-Indices oder durch Register
erschlossen.
Die Bearbeitung und Auswertung erfolgt mit
dem Programmsystem TUSTEP. Bisher wurden folgende
Listen angefertigt, die den Benutzern zur Verfügung stehen:
Die Erfahrungen, die mit dieser kleinen, für
Unterrichtszwecke angelegten Sammlung bisher gemacht
wurden, sind befriedigend. Größere wissenschaftliche
Projekte, wie sie gegenwärtig besonders im Ausland
betrieben werden, sind mit unserem geringen, durch die
Streichung von Hilfskraftgeldern reduzierten Potential
nicht durchführbar. Entsprechende Anfragen aus Italien und
Holland konnten deshalb bisher nicht positiv beantwortet werden.
Der EDV-Einsatz ist nicht überflüssig, da es sich
bei den Benutzern nur selten um ausgebildete Archäologen,
Kunsthistoriker usw. handelt, sondern meistens um
Studenten, die auch mit geringen Vorkenntnissen eine
gewisse Auswahl aus der Sammlung treffen können sollen.
Durch einen größeren Aufwand bei der Rubrizierung, bei
der Ausfüllung des Auftragsblattes, bei der Datenpflege
und bei der Programmierung könnten auch höhere Ansprüche
an die Erschließung der Diasammlung gestellt und erfüllt werden.
Die Romanische Bibliographie besteht seit 1877, die
Dokumentationsstelle in Göttingen seit 1967. Nach dem
sprunghaften Anwachsen der Publikationsmenge in den 60er
Jahren folgte in den 70er Jahren in Deutschland ein
mit EDV-Vorhaben verschiedener Art belasteter
Bibliographie-Boom, der 1980 - auch das Bundesministerium
für Forschung und Technologie hatte sich 1977 noch
eingeschaltet - im Zuge der Finanzkrise zu einem jähen Ende kam.
Für weitere Erörterungen zur Frage der Bibliographie im
Romanischen verweisen wir auf die jeweiligen Vorworte in
den einzelnen Bänden der Bibliographie. Als kompetenten
Kritiker nennen wir Dr. Klaus Schreiber in Stuttgart (vgl.
zuletzt: Zeitschrift für Bibliothekswesen und
Bibliographie 29, 1982, 215-220).
Wir definieren die Vollständigkeit funktional, und zwar
mit der Feststellung, daß eine wissenschaftliche
Bibliographie den Zugriff auf ein Objekt zu dokumentieren
habe. Entsprechend den Verzeichnissen im jeweiligen
Band I enthält die Romanische Bibliographie Aufsätze
aus Zeitschriften, Sammelbänden, Kongreßberichten und
Festschriften. Dazu gehören auch Personalia und
Berichte über Institute. Bücher werden erst dann
erfaßt, wenn sie rezensiert werden. Dieses Verfahren setzt
ein beträchtliches Vertrauen in das Rezensionswesen voraus.
Die Rezensionen, die unter den einzelnen Einträgen
erscheinen, im Rahmen der Erfassung jedoch rund ein
Drittel der gesamten
Titelmenge umfassen, müssen von Hand zugeordnet werden. Ein
technisches Verfahren für die Zuordnung konnte bislang
noch nicht entwickelt werden. Die Tatsache, daß die
Rezensionen verzeichnet werden, halten wir für eine
wichtige Leistung der Romanischen Bibliographie.
Die inhaltliche Gestaltung der Bibliographie hängt von
den jeweiligen besonderen Konzeptionen der
Wissenschaft ab. Man hat z.B. die Indogermanistik
ausgeschieden, die neuere Angewandte Linguistik, die
über eigenständige bibliographische Unternehmungen
verfügt, jedoch nicht einbezogen.
Die Literaturwissenschaft des Französischen, die immerhin
rund 5000 Titel plus Rezensionen, d.h. ein Drittel
der gesamten Bibliographie ausmachen würde, wurde auf
Drängen der Gesellschaft für Information und
Dokumentation (GID) ausgeschieden, da im Bereich der
französischen Literatur durch die ausführliche
Dokumentation von Klapp mit Überdokumentation gerechnet
werden mußte. Beim Vergleich der beiden Bibliographien
wurde auch auf Probleme des Rasters hingewiesen.
Als Schlüssel bezeichnen wir eine systematische
Auflistung der Positionen der betroffenen Disziplinen.
Die Zuordnung der erfaßten Daten zu den entsprechenden
Positionen wird als elementare Form einer inhaltlichen
Erschließung begriffen. Der Systemschlüssel, der
1968 erstellt wurde, ist den Schwankungen der
wissenschaftlichen Erkenntnisinteressen besonders stark
ausgesetzt. Der Schlüssel wird für jeden Berichtszeitraum
neu angepaßt. Dies geschieht allerdings - im Hinblick
auf eventuelles Retrieval - so, daß keine
maßgeblichen Positionen verändert werden.
Kritik am Schlüssel war nicht fachlicher Art - er ist
mittlerweile auch anderweitig übernommen worden -,
sondern betraf die sogenannte Benutzerfreundlichkeit. Wir
sind jedoch der Auffassung, daß eine
wissenschaftliche Bibliographie Fachkenntnisse voraussetzen muß.
Das Erfassungsschema wurde im Verlaufe der Jahre
mehrmals geändert, auch wenn die wesentlichen Positionen
von der Sache her vorgegeben sind. Doch sei hier
ausdrücklich darauf hingewiesen, daß das vom Tübinger
Zentrum für Datenverarbeitung entworfene Schema sehr
handlich und flexibel ist, im Vergleich zu anderen auch
nicht aufwendig.
Das Schema umfaßt sieben Kategorien:
Die Dokumentationsstelle ist ein wenig kostenintensiver
Kleinbetrieb. Der Stellenplan umfaßt eine BAT-Stelle mit
25 Wochenstunden, zwei examinierte und eine
nichtexaminierte Hilfsassistentenstelle zu je 20
Wochenstunden. Der Max-Niemeyer-Verlag beteiligt sich an
der Finanzierung.
Angesichts der stets kritisch und mit planerischem
Optimismus debattierten Frage des zeitlichen Rückstandes
der Bibliographie auf den jeweiligen Berichtszeitraum
macht man zur Zeit eine vollkommen neue Erfahrung.
Jetzt, d.h. seit Ende März 1983, wird die Romanische
Bibliographie für 1979/80 exzerpiert. Bei diesem geringen
Abstand ist es außerordentlich schwierig und
administrativ aufwendig geworden, das Datenmaterial zu
beschaffen, und dies auch dann, wenn die
Universitätsbibliothek Göttingen alle nur wünschenswerte Hilfen gibt.
Die Grunde dafür sind folgende: Viele Periodica
sind im Rückstand. Infolge finanzieller Schwierigkeiten
entstehen Lücken in den Beständen der Bibliotheken.
Die Fernleihe ist oft mühsam, weil die Bibliotheken die
ungebundenen Bestände nicht gern herausgeben. Niemand hat
daran gedacht, daß in dieser Situation auch die oben
genannten Hilfsmittel für die Erfassung (zumal im Falle
der modernen Literaturen) nicht mehr aktuell genug sind.
Wir haben stets daran festgehalten, daß vier bis sechs
Jahre Abstand eine realistische Größe darstellen.
Dies gilt allerdings nur dann, wenn man sich vornimmt, die
Bibliographie in periodischen und einigermaßen kompakten
Berichtszeiträumen erscheinen zu lassen. Im Falle der
Romanischen Bibliographie bleibt außerdem zu bedenken,
daß nicht allein die zentraleuropäische Situation,
sondern auch die Bedingungen in Randzonen und in anderen
Kontinenten (zumal in Südamerika) ihren Ausschlag geben.
Nach dem Gesagten drängt sich abschließend noch ein Wort
zur Organisation der Dienste auf, wie sie von seiten der
Informationswissenschaften immer wieder gefordert werden.
Es scheint jedoch, daß eine Bibliographie in Buchform, die
für den Betrieb der Geisteswissenschaften übrigens
ausreicht, nicht gleichzeitig mit einem Dienst
betrieben werden kann. Abgesehen von einer stärkeren
bibliographischen Infrastruktur verlangt ein Dienst vor
allem mehr und insbesondere spezialisierteres Personal
(Disziplinen bzw. Ressorts der Sprach- und
Literaturwissenschaften, Enzyklopädik,
Fremdsprachenkenntnisse). Es ist unseres Wissens
bislang auch nicht ausgemacht, ob von Benutzerseite Dienste
tatsächlich gefordert werden. Sicher scheint allein, daß
ausgebaute Dienste in den Geisteswissenschaften zu
kostenaufwendig sind. Das Buch erfüllt auch in der
Dokumentation immer noch seine Funktion.
Die EDV-Verarbeitung umfaßt nach der Datenerfassung
Arbeitsgänge zur Datenprüfung, Korrektur, Auflösung von
Kürzeln, Sortierung, Einfügung von
Zwischenüberschriften, Register-Erstellung und
Lichtsatz-Ausgabe der gesamten Bibliographie. Seit dem
Berichtszeitraum 1975/76 wurden, u.a. aus den oben
erwähnten Finanzierungsgründen, diese EDV-Arbeiten auf
Initiative des Verlages nach Tübingen verlegt und hier
mit Hilfe von TUSTEP durchgeführt. Neben einer
Vereinfachung im Erfassungs-Schema ergaben sich mit dieser
Umstellung weitere wesentliche Vorteile gegenüber der
vorherigen Verarbeitung: So ist die Korrektur jetzt viel
sicherer und läßt sich rascher durchführen, weil in
den EDV-Listen keine Prototypen für Akzentbuchstaben
erscheinen, sondern die endgültigen Zeichen. Es sind zwei
Korrektur-Stufen vorgesehen: in den Eingabedaten und nach
der Sortierung. Für die Zeitschriftentitel, die über
einen numerischen Code erfaßt werden, wurde die Sicherheit
bei der Erfassung durch die Einführung einer Prüfziffer
erhöht. Für den Benutzer am deutlichsten sichtbar ist die
Verbesserung der typographischen Gestaltung, die sich
z.B. in der Einführung lebender Kolumnentitel zeigt.
Hubert Cancik, Hubert Mohr (Philologisches Seminar)
Erschließung einer Lehr-Dia-Sammlung durch EDV
1. Projektvorstellung
2. Arbeitsablauf
3. Programme und Listen
Die Rubriken 7 - 9 sind fakultativ, die Rubriken 2
und 4 verwenden vorgegebene Codierungs-Kürzel: In der
Rubrik 4 "Art des Gegenstandes" wird der Benennung des
Gegenstandes jeweils eine der vorgegebenen zehn
Kategorien als Kürzel vorangestellt. Für die Ortsnamen in
Rubrik 2 ist ein festes Raster von Regionen bzw.
Provinzen in Kürzelform vorgegeben. Für dieses Raster
wurden die römische Provinzialeinteilung bzw. die
Augusteischen Regionen innerhalb Italiens zugrunde
gelegt. Für Griechenland wurde eine an den historischen
Landschaften orientierte Einteilung angewendet. Hit Hilfe
dieser Rastereinteilungen lassen sich Listen herstellen,
in denen die Dias bzw. ihre Inhalte nach den
übergeordneten Kategorien des "Gegenstandes" bzw. der
"Regionen" zusammengestellt sind.
4. Ausbau- und Kooperationsmöglichkeiten
Diskussion:
Das vorliegende Projekt hat keine vollständige und
umfassende wissenschaftliche Erschließung der
Diasammlung zum Ziel. Unschärfen werden bewußt
in Kauf genommen. So konnte z.B. eine griechische Vase in
der Rubrik 4 unter "Keramik", unter "Gerät" oder unter
"Malerei" eingeordnet bzw. gesucht werden. In der
Praxis müssen deshalb bei der Zuordnung zu den
vorgesehenen Kategorien Schwerpunkte gebildet werden.
Gustav Ineichen (Seminar für Romanische Philologie, Universität Göttingen),
Hannelore Ott (pagina GmbH, Tübingen)Romanische Bibliographie:
EDV-gestützte Erstellung,
Erschließung und Publikation1. Allgemeines zur Romanischen Bibliographie
2. Vollständigkeit
3. Umfang und Inhalt
4. Systemschlüssel
5. Erfassung
Als Hilfsmittel für die Erfassung dienen ein Handapparat
mit annotierten Nachschlagewerken und betriebsinterne Karteien.
Trotzdem muß jedes Erfassungsblatt mindestens einmal
kontrolliert werden. Die möglichen Fehler sind fachlicher
Art oder Strukturfehler. Wir sehen deshalb davon ab, die
Erfassung direkt an einem Terminal vorzunehmen, da
diese Art der Erfassung zu anfällig gegen sachliche
Fehler ist. Die Datenerfassung wird deshalb nach unseren
Manuskripten vom Verlag (auf einer Schreibmaschine mit
OCR-Kugelkopf) durchgeführt. Ein immer wieder
gravierendes Problem in diesem Zusammenhang sind die
verschiedenen Fremdsprachen.
6. Personelle Ausstattung
7. Zeitlicher Rückstand
8. Buchbibliographie versus Informationsdienste
9. EDV-Einsatz
(Die Kurzfassungen der Referate wurden von den Referenten zur Verf�gung gestellt.)
Zur
Übersicht über die bisherigen Kolloquien
tustep@zdv.uni-tuebingen.de - Stand: 25. September 2002