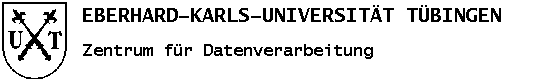
Protokoll des 37. Kolloquiums über die Anwendung der
Elektronischen Datenverarbeitung in den Geisteswissenschaften
an der Universität Tübingen vom 5. Juli 1986
Allgemeine Information
TUSTEP steht inzwischen für die Betriebssysteme OS 1100 (UNIVAC), BS3000 (Siemens), MVS und VM/CMS (IBM) zur Verfügung; es wurde bisher an folgende Universitäten weitergegeben: Berlin, Bonn, Göttingen, Heidelberg, Konstanz, Marburg, München, Münster, Trier und Würzburg.Johann Cook (Dept. of Semitic Languages, Universität Stellenbosch/Südafrika)
Textkritische und grammatikalische Untersuchungen zum Alten Testament (Urtext und Übersetzungen)
Der Rechner hat in Bezug auf Text-Analysen eine neue Ära eingeleitet. In der Wissenschaft vom Alten Testament kann man deshalb mit diesem Hilfsmittel textkritische und grammatikalische Analysen durchführen, die früher kaum denkbar waren.Das Projekt, von dem hier berichtet wird, wird vom "Human Sciences Research Council", einer der DFG vergleichbaren Institution in Südafrika, und von der Universität Stellenbosch unterstützt. Es dient vor allem der grammatikalischen und textkritischen Untersuchung des Alten Testaments (AT). Mein eigenes Arbeitsgebiet ist primär der Rechnereinsatz für die oben genannten Untersuchungen.
Die Grundlage für unsere textkritische Arbeit ist das Studium der Übersetzungstechnik, z.B. der Septuaginta (griech. Übersetzung), der Targumim (aramäische Übersetzung) und der Peshitta (syrische Übersetzung). Aus der Übersetzung kann man feststellen, wie wortgetreu ein Übersetzer seine Vorlage wiedergegeben hat. Wenn ein Übersetzer ein bestimmmtes hebräisches Wort immer mit demselben Äquivalent übersetzt hat, darf man annehmen, daß er seine Vorlage buchstabengetreu wiedergegeben hat. Es ist immer wieder umstritten, ob eine bestimmte Variante tatsächlich eine hebräische Lesart repräsentiert oder ob eine bewußte Änderung des Übersetzers vorliegt, um den übersetzten Text deutlicher zu machen. Man kann eine solche Entscheidung nur auf Grund einer grundsätzlichen Kenntnis des Charakters der Übersetzung im Ganzen treffen.
Zur Zeit existieren einzelne mit dem Computer erstellte Datensammlungen (data bases) des hebräischen Urtextes und der Übersetzungen, die vom Referenten mit TUSTEP bearbeitet werden.
1. Eine Datensammlung für die syrische Übersetzung des AT
Die Peshitta-Version des AT ist eine wichtige Quelle für die Textkritik. Aber bevor man sie richtig einsetzen kann, muß man ihre Entstehung analysieren: Sie ist beeinflußt von verschiedenen Übersetzungen des AT, der Septuaginta, den Targumim, von den jüdischen exegetischen Traditionen u.a. Diese Einflüsse kann man genau feststellen, wenn man die Übersetzungstechnik des Übersetzers kennt.Die morphologische Analyse des syrischen Textes wird halbautomatisch durchgeführt. Aus den festgestellten Übersetzungs-Äquivalenten wird im Computer ein Wörterbuch aufgebaut, in das neu analysierte Wörter laufend eingefügt werden. Anhand von hebräisch-syrischen und syrisch-hebräischen Parallel-Listen kann man die Übersetzungstechnik studieren.
2. Eine Datensammlung für die biblischen Schriftrollen aus Qumran
Es ist nicht einfach, alle publizierten Qumran-Texte zu bekommen, um sie mit dem Computer bearbeiten zu können. Über das orthographische System und die linguistischen Merkmale einzelner Rollen ist schon viel spekuliert worden. Ziel unserer Datensammlung ist hier eine standardisierte Beschreibung der erfaßten Texte, um bei der Lösung der genannten Probleme weiterzukommen.3. Analyse der Septuaginta mit Hilfe von CATSS
Die "Computer Assisted Tools for Septuagint Studies" sind von Emanuel Tov (Jerusalem) und Robert A. Kraft (Pennsylvania, USA) entworfen worden, um das Datenmaterial für die Erforschung aller Aspekte der Septuaginta bereitzustellen. CATSS besteht aus:- einer parallelen Anordnung in Spalten von allen Elementen der Septuaginta und des hebräischen Textes;
- einer Sammlung aller Varianten der Göttinger und der Cambridger Edition;
- einer morphologischen Analyse sämtlicher Wörter der Septuaginta;
- einer morphologischen Analyse des hebräischen Textes.
Ein Beispiel:
Die hebräische Präposition "B" kommt 744 Mal in der Genesis vor.
- In 357 Fällen wird sie mit der griechischen Präposition εν [en (griech.)] wiedergegeben;
- mit επι [epi (griech.)]: 52
- mit εις [eis (griech.)]: 21
- mit μετα [meta (griech.)]: 16
- mit δια [dia (griech.)]: 14
- mit κατα [kata (griech.)]: 16
- mit αντι [anti (griech.)]: 11
- mit προς [pros (griech.)], απο [apo (griech.)], προ [pro (griech.)]: 4.
- In 14 Fällen sind keine Äquivalente für diese Präposition vorhanden.
Anschließend wurde anhand einer invertierten Liste die griechische Präposition εν untersucht: In 48 % der Fälle ist εν als Äquivalent von "B" benutzt. Eine entsprechende Untersuchung mehrerer Wörter ergibt, daß dieser Übersetzer relativ wortgetreu übersetzt hat.
Wenn man bedenkt, daß die Septuaginta aus ca. 20.000
CATSS-Einträgen besteht, kann man verstehen, welch ein
nützliches Hilfsmittel der Computer ist.
Das Projekt, an dem zwei Bibliothekarinnen und ein
Wissenschaftler, zeitweise noch von einer Halbtagskraft
unterstützt, seit Ende 1977 arbeiten, ist von der
Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) mit erheblichen
Mitteln gefördert worden. An einem Beispiel möchte ich
zeigen, welche Bedeutung literarische Zeitschriften
als Quellen, als Gegenstand und als Auskunftsmittel für
die Literaturwissenschaft haben.
Das Beispiel stammt zwar nicht aus dem Berichtszeitraum
des Marbacher Repertoriums, hat aber den Vorteil, bekannt
zu sein. Es ist Goethes Gedicht "Willkommen und
Abschied", das zuerst im März 1775 in einer Zeitschrift,
in Jacobis "Iris", veröffentlicht wurde. Das Gedicht
soll hier nicht vollständig zitiert werden; in ihm werden
der plötzliche Aufbruch, ein nächtlicher Ritt, die
Ankunft und der Abschied von der Geliebten beschrieben.
Ich beschränke mich darauf, die ersten beiden Verse aus
der Zeitschrift den zwei Zeilen der späteren Fassung
aus den "Schriften" von 1789 gegenüberzustellen:
"Es schlug mein Herz, geschwind zu Pferde!
Über die Unterschiede beider Fassungen, besonders der
zweiten Zeile (und Variationen in folgenden Versen), ist
viel geschrieben und gesagt worden, worauf ich hier nicht
eingehen will. Das Beispiel zeigt, wie wichtig neben der
handschriftlichen Überlieferung die verschiedenen
(autorisierten) Druckfassungen eines Werkes sind.
Für die Jahre ab 1880 sind dabei Zeitschriften von weit
größerer Bedeutung als zur Goethezeit, sie sind oft genug
der Ort der ersten Veröffentlichung eines Werks. In
besonderem Maße gilt dies für den literarischen
Expressionismus in und nach dem ersten
Weltkrieg. Sehr viele Beiträge sind in Rücksicht auf und
für die expressionistischen Zeitschriften geschrieben
worden, sie müssen daher in diesem Zusammenhang gelesen
und untersucht werden. Zeitschriften sind also nicht nur
Fundorte für Texte, sie können auch selbst zum
Gegenstand der Literaturwissenschaft werden. Dies gilt
vor allem für ein anderes Beispiel, das ich nennen
möchte, für die "Fackel" von Karl Kraus. Diese
Zeitschrift ist das Werk eines Mannes, und das Werk
dieses Mannes ist seine Zeitschrift.
Zeitschriften enthalten aber, das ist bekannt, nicht nur
Werke der anerkannten Literatur. Gerade auflagenstarke
Blätter wollten und wollen der Unterhaltung, auch in
literarischer Form, dienen. Dieses Gebiet ist in den
letzten Jahren von der Literaturgeschichte und der
Literatursoziologie eingehender untersucht worden. Auf
andere Fragen dieser Disziplinen geben fast ausschließlich
Zeitschriften eine Antwort: Welche literarischen
Richtungen sind von wem gefördert bzw. bekämpft worden?
Wie sahen die Bemühungen aus, den literarischen Geschmack
zu verändern? Was wurde überhaupt von welchen Schichten gelesen?
In der Literaturwissenschaft hat es einige Unternehmen
gegeben, die literarisch interessanten Blätter zu
verzeichnen, wobei man sich aber immer auf die wichtigsten
Blätter oder auf einen je nach Forschungsinteresse
bestimmten Teil beschränken mußte. Seit Anfang der 70er
Jahre werden alle literarisch wichtigen Blätter mit
Unterstützung der DFG in mehreren Projekten
bibliographisch verzeichnet und für die
Fachwissenschaft kommentiert. Die vor 1880 im 19.
Jahrhundert erschienenen Blätter wurden von einer
Gruppe in Frankfurt bearbeitet, die Blätter von 1880 bis
1945 im Deutschen Literaturarchiv in Marbach a.N.
Unsere Aufgabe scheint nicht weiter schwierig zu sein,
aber die Probleme stecken im Detail. Ich möchte davon nur
eines erwähnen, die Auswahl der in das Marbacher
Repertorium aufzunehmenden Zeitschriften. Da alle
literarisch wichtigen Blätter zu verzeichnen sind,
müssen auch alle allgemeinen Kulturzeitschriften geprüft
werden. In vielen Fällen sind sie aufzunehmen, da
Literatur im Berichtszeitraum ein Teil der allgemeinen
Bildung ist und in diesen Zeitschriften gedruckt und
behandelt wird. Der Wert eines solchen Nachschlagewerks
steigt aber nicht, wenn es durch eine Vielzahl
literarisch unbedeutender Blätter aufgeschwemmt wird, in
denen einmal ein Gedicht nachgedruckt wurde;
außerdem sollte das Repertorium in einer absehbaren Zeit
abgeschlossen werden. Daher mußten geeignete Kriterien
gefunden werden, mit denen eine Zeitschrift geprüft und
über ihre Aufnahme entschieden werden konnte. Es
wurden ungefähr 16.000 Titel gesammelt, von denen gut 11.000
anhand von zumeist drei Probejahrgängen geprüft
wurden, während die übrigen schon aus äußeren Gründen
ausgeschieden werden konnten. Im Marbacher Repertorium
werden schließlich über 3.200 Zeitschriften mit zusammen
fast 20.000 Jahrgangsbänden verzeichnet werden.
Dafür haben wir keine Bibliothekskataloge oder andere,
gedruckte Verzeichnisse exzerpiert, sondern wir haben alle
Titel und Jahrgänge in Autopsie bearbeitet; alle Angaben
im Repertorium wurden aus den Zeitschriften selbst
entnommen. Um diese Arbeit vor allem bei größeren
Formaten und bei vielen Jahrgängen, z.B. der
Familienblätter, leisten zu können, waren längere
Aufenthalte in den besitzenden Bibliotheken notwendig, vor
allem in der Deutschen
Bücherei in Leipzig, in der Österreichischen
Nationalbibliothek in Wien und in der
Staatsbibliothek Preußischer Kulturbesitz in Berlin.
Als das Projekt Ende 1977 begonnen wurde, gab es noch
keine Personal-Computer und erst recht keine tragbaren
Geräte, mit denen man auf Reisen die gesuchten
Angaben aus den einzelnen Zeitschriften in
elektromagnetischer Form hätte speichern können. Die
Merkmale, mit denen eine Zeitschrift beschrieben
werden kann, mußten auf traditionelle Weise auf besonderen
Erfassungsbögen festgehalten werden. Die Beschreibung
ist weit ausführlicher als eine bibliothekarische
Titelaufnahme für einen Bibliothekskatalog oder in einer
üblichen Bibliographie; in der Regel werden Titel und
Titeländerungen, sämtliche Untertitel, Herausgeber,
Redakteure, Erscheinungsort und Verlag immer in allen
Änderungen genannt; jeder Jahrgang wird mit Heftzahl und
den Erscheinungseckdaten aufgeführt; es folgen Nachweise
über das Ende einer Zeitschrift (ein wichtiger Punkt),
über Vorgänger und Nachfolger, Beilagen, Jahresregister,
Auflage (sofern vorhanden) und weitere Einzelheiten sowie
über die Standorte der Exemplare, die wir benutzt
haben. Schließlich wird jeder Titel durch ein oder mehrere
Schlagworte charakterisiert, es wird aus dem Programm
der Zeitschrift zitiert, oft werden die Rubriken der
Jahresregister genannt, und es wird die Literatur über
eine Zeitschrift verzeichnet. Außerdem werden
Beiträger, aber nur in einer Auswahl, genannt; eine
vollständige Liste der Mitarbeiter hätte ein Erscheinen
des Repertoriums über Jahre hinaus verzögert; die Auswahl
soll dazu dienen, eine Zeitschrift näher zu
charakterisieren. Weil das Marbacher Projekt auf diese
Weise über die sonst bekannten, auch über kommentierte
Bibliographien hinausgeht, werden die später gedruckten
Bände von uns Repertorium genannt.
Es lag nahe, die spätere Veröffentlichung in Buchform mit
Hilfe der EDV vorzubereiten. Auf diese Weise können nicht
nur erhebliche Satzkosten, über DM 100.000.-, gespart
werden, mit Hilfe der TUSTEP-Kommandos ist es auch
möglich, die umfangreichen Register und die Verweisungen
bei Titelwechseln durch den Rechner erzeugen zu lassen.
Die spätere gedruckte Darstellung der Zeitschriften folgt
weitgehend einem bestimmten Schema; nach dem Titel und
der Laufzeit werden die einzelnen Teile der
Beschreibung sozusagen unter einer Überschrift genannt,
die kursiv gesetzt wird. Dazu gehören z.B. Untertitel,
Herausgeber, Redakteure, Ort und Verlag, das oder die
Schlagwort(e) und die Beiträger. Da der Text auch
innerhalb der einzelnen Teile in einer festgelegten
Form steht, kommt man fast immer ohne aufwendige
Kennzeichen für die Registereinträge und die
Verweisungen aus. Nur in dem Teil der Beschreibung, in dem
Ort(e) und Verlag(e), also zwei verschiedene Begriffe
eingetragen werden, halten wir Ort und Verlag mit
besonderen Zeichen auseinander. Die Kommandos für das
Erzeugen der Verweisungen, für das Sortieren aller
Zeitschriftenbeschreibungen und für das Erzeugen der
Register wurden schon zu Beginn der Texteingabe
geschrieben und erprobt. Schätzungsweise 20% des später
gedruckten Textes werden durch TUSTEP erzeugt werden.
Der Text wurde zuerst mit Schreibmaschine und in
OCRA-Schrift geschrieben und in Ulm eingelesen. In der
Zwischenzeit wird ein PC benutzt, die Disketten werden
nach Tübingen geschickt und auf
Magnetband konvertiert. An einem PC arbeitet man nicht nur
komfortabler als an der Schreibmaschine, man macht
auch weniger Fehler, wie wir jetzt beim Korrekturlesen
feststellen. Die Texteingabe an einem PC ist aber mit den
heutigen Textverarbeitungsprogrammen auch bequemer als an
dem Terminal eines Großrechners;
die Bequemlichkeit läßt sich steigern, wenn man die
Tastatur frei belegen und eine Datei mit Textbausteinen
benutzen kann, die durch das Eintippen eines Schlüssels in
den Text eingefügt werden. Wird der Text in weitgehend
schematisierter Form eingetippt, kann man eine Maske
benutzen. Die in Marbach verwendete Maske enthält die
einzelnen Teile der Beschreibung einer Zeitschrift (wie
"Untertitel", "Herausgeber" etc.) und - in symbolischer
Form - Steuerzeichen für die TUSTEP-Kommandos. Die
einzelnen Felder in dieser Maske werden angesprungen und,
wenn nötig, ausgefüllt, sonst gelöscht. Natürlich hat
die Textverarbeitung auf einem PC auch Grenzen; von den
erweiterten Anweisungen, die der TUSTEP-Editor zur
Verfügung stellt, wird man die wenigsten in einem
handelsüblichen Textprogramm finden. Diese Anweisungen
werden aber in aller Regel nicht benötigt, während die
große Masse eines Textes eingetippt wird, sondern erst
während seiner Redaktion. Die beschriebene Form der
Dateneingabe hat sich im Marbacher Projekt sehr bewährt,
sie ist deutlich bequemer, schneller und, wie schon
gesagt, auch sicherer als andere Methoden.
Trotzdem muß natürlich auch bei unserem Text Korrektur
gelesen werden. Er wird in Tübingen in einigen
Kontrolläufen auf formale Fehler geprüft und dann auf dem
Schnelldrucker formatiert ausgegeben. (Der Zeichensatz
des Schnelldruckers reicht für unsere Bedürfnisse.) Anhand
des formatierten Ausdrucks wird Korrektur gelesen, so
daß nur die Wirkung der Steuerzeichen, nicht die Zeichen
selbst kontrolliert werden müssen.
Der nächste Schritt, das Korrigieren des eingegebenen
Textes, ist durch die Entfernung zwischen Marbach und
Tübingen umständlicher als vor Ort. Es gibt zwar eine
Datex P-Leitung zwischen einem Sichtgerät in Marbach
und den Tübinger Rechnern, die Kosten für diese Leitung
sind aber das teuerste in der ganzen Prozedur. (Die feste
Gebühr für eine Datex P-Leitung mit einer
Übertragungsgeschwindigkeit von 1.200 baud liegt bei DM
180.- pro Monat, dazu kommen noch einmal
Benutzungsgebühren etwa in der gleichen Höhe.) Deshalb
wird die Leitung vor allem dazu benutzt, Kommandos zu
geben und Jobs zu starten, die meistens im Batch
laufen, und nur in Ausnahmefällen für die Redaktion
eines Abschnitts. Abgesehen von einer etwas lahmen
Reaktionszeit des Sichtgeräts aufgrund der nicht
sehr hohen Übertragungsgeschwindigkeit ist kein
Unterschied zur Arbeit an einem Tübinger Terminal
festzustellen. Man sollte sich allerdings immer korrekt
ausloggen und zum Schluß "den Hörer auflegen", sonst
erlebt man Überraschungen. Der Text selbst wird wieder auf
dem PC korrigiert, und die Disketten werden wieder
nach Tübingen geschickt.
Ein gewisses Problem ist der Transport der Listen von
Tübingen nach Marbach; zur Zeit wird es durch einen
Kollegen gelöst, der seinen Hauptwohnsitz in Tübingen hat
und am Wochenanfang als Tübinger Datenbote nach Marbach fährt.
Die Kombination von PC zur Dateneingabe vor Ort und
Großrechner mit den TUSTEP-Programmen hat sich bewährt, so
daß in einem Folgeprojekt, in dem die literarischen
Zeitschriften aus den Jahren
1945 bis 1970 verzeichnet werden, von Anfang an mit der
EDV gearbeitet wird. In diesem Projekt hat jeder
Mitarbeiter einen PC, mit dem er die bibliographischen
Angaben der Zeitschrift, die er gerade bearbeitet, auf
Diskette schreibt. Auch der Teil der Arbeit, der vor
diesem Schritt liegt, wird vollständig mit Hilfe der EDV
erledigt. Die Zeitschriften, die in das Repertorium
aufgenommen werden sollen, müssen in einer Kartei
geführt werden, die die Standorte der besitzenden
Bibliotheken und noch vieles mehr enthält. In dem
ersten Marbacher Projekt sind dafür über 25.000
Karteikarten geschrieben worden, in dem neuen wird eine
Datenbank benutzt.
Deutsche literarische Zeitschriften 1880-1945. Ein Repertorium
Thomas Dietzel (Deutsches Literaturarchiv, Marbach)
Repertorium deutscher literarischer Zeitschriften 1880-1945
Am Deutschen Literaturarchiv Marbach a.N. ist ein
Repertorium deutschsprachiger literarischer Zeitschriften
der Jahre von 1880 bis 1945 vorbereitet worden. Darin
werden die literarisch bedeutsamen Zeitschriften
bibliographisch ausführlich beschrieben und sachlich
kommentiert. Das Repertorium wird im Druck vier Bände
und einen Registerband umfassen und 1987 erscheinen
[siehe den Literaturhinweis am Schluß dieses Referates].
Es wird für die deutsche Literaturwissenschaft ein
umfassendes Nachschlagewerk der literarischen
Zeitschriften sein, es wird aber auch für
Nachbardisziplinen und für die Bibliotheken ein nützliches
Hilfsmittel werden; die Antiquare werden damit einen
Großteil der gesuchten Zeitschriften der Moderne bestimmen können.
"Mir schlug das Herz, geschwind zu Pferde!
Und fort! wild, wie ein Held zur Schlacht."
(Aus Jacobis "Iris", 1775)
Es war getan fast eh gedacht."
(Aus den "Schriften", 1789)
4 Bände und 1 Register-Band.
Hrsg.: Deutsches Literaturarchiv, Marbach
Bearb.: Thomas Dietzel und Hans O. Hügel
München: Saur 1987
ISBN 3-598-10645-9
(Die Kurzfassungen der Referate wurden von den Referenten zur Verf�gung gestellt.)
Zur
Übersicht über die bisherigen Kolloquien
tustep@zdv.uni-tuebingen.de - Stand: 17. Juni 2003