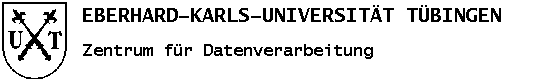
Protokoll des 45. Kolloquiums über die Anwendung der
Elektronischen Datenverarbeitung in den Geisteswissenschaften
an der Universität Tübingen vom 17. Februar 1989
Allgemeine Information
Kyrillisch in TUSTEPSeit dem Frühjahr 1989 können mit TUSTEP auch kyrillische Texte gedruckt werden.
Norbert Richard Wolf (Institut für Deutsche Philologie, Würzburg)
Computergestützte sprachwissenschaftliche Untersuchungen an frühneuhochdeutschen Texten
1. Textkorpus
Jede sprachwissenschaftliche Untersuchung bedarf eines Textkorpus, dies sowohl bei gegenwartssprachlichen Analysen als auch und viel mehr bei Beschreibungen historischer Sprachstufen, weil hierfür wohl jede Sprecherkompetenz fehlt. Mit Hilfe eines Textkorpus wird es möglich, daß sich der Sprachwissenschaftler eine Ersatzkompetenz schafft. Für diese Zwecke empfiehlt es sich überdies, auf umfangreiche Texte zurückzugreifen, die - zumindest teilweise - synonyme Formulierungen enthalten, die wiederum ein Ersatz für Analyseoperationen ("Test", "Proben") sein können.Dazu kommt, daß wir es vor allem im Mittelalter mit unfesten Texten zu tun haben. Je nach Entstehungsort, -raum, -zeit und -situation wird ein Text bei neuerlichem Gebrauch inhaltlich oder/und sprachlich aktualisiert, so daß sich heute einerseits gar keine ursprüngliche Fassung mehr rekonstruieren läßt; andererseits würde dieses Vorgehen den tatsächlichen Befund verfälschen, weil die Unfestigkeit der Texte ihre Historizität, somit ihr tatsächliches "Leben" ausmacht. Derart dynamische Texte benötigen "dynamische Editionen", wobei sich das Adjektiv "dynamisch" in dreifachem Sinne versteht:
- Eine Edition sollte auch die Textgeschichte weitestgehend nachvollziehen lassen. Die jüngst erschienenen Ausgaben der sog. "Rechtssumme" Bruder Bertholds (4 Bände, Tübingen 1987) und des "Vocabularius Ex quo" (die ersten drei Bände, Tübingen 1988) sind Versuche, gerade auch die Textdynamik zu dokumentieren.
- Historiker z.B. stellen an die Edition mittelalterlicher Texte andere Forderungen als Germanisten, insbesondere Sprachwissenschaftler. Eine maschinenlesbare Edition mit entsprechenden Kodierungen und Varianten könnte verschiedenen Bedürfnissen entgegenkommen.
- Eine Edition sollte auch in dem Sinne dynamisch sein, daß sie als Grundlage für weitere Arbeiten dient, bei denen der Text nach unterschiedlichen Kriterien (automatisch) geordnet und durchsucht werden kann.
2. Die Würzburger Wortbildungsuntersuchungen
Das Teilprojekt 4 des Sonderforschungsbereichs 226 "Wissensorganisierende und wissensvermittelnde Literatur im Mittelalter" (Würzburg/Eichstätt) untersucht derzeit auf der Basis maschinenlesbarer Editionen die Wortbildung des Substantivs im Frühneuhochdeutschen. Es hat sich dabei erwiesen, daß das Textkorpus nur umfangreiche Ganztexte enthalten darf, weil sonst das Bild sehr stark verfälscht würde. In der "Summa legum" des Dr. Raymundus von Wiener Neustadt, einem Rechtstext aus dem Jahre 1345, z.B. wären pro Seite zwei Belege für Abteilungen mit dem Suffix ung zu erwarten, doch die tatsächliche Verteilung sieht, wie die Statistik zeigt, ganz anders aus:1145 Belege, S. 123-686 = 564 Seiten, 2 Belege je Seite
von bis Seitenzahl Belege erwartet Differenz 123 172 50 64 102 -38 173 222 50 71 102 -31 223 272 50 72 102 -30 273 322 50 102 102 0 323 372 50 68 102 -34 373 422 50 124 102 22 423 472 50 111 102 9 473 522 50 169 102 67 523 572 50 122 102 20 573 622 50 95 102 -7 623 672 50 94 102 -8 637 686 50 135 102 33
Alleine die Tatsache, daß die zu untersuchenden Korpustexte (zusammen sieben Texte mit insgesamt 1,07 Millionen Wörtern) maschinenlesbar vorhanden sind, macht sie in relativ kurzer Zeit bearbeitbar. Vor- und rückläufige Wortformenregister helfen beim Auffinden der Prä- und Suffixe, eine Datenbank ermöglicht das Ordnen und systematische Beschreiben der vorgefundenen Strukturen.
Es leuchtet ein, daß solche Untersuchungen nur noch mit
EDV-Unterstützung möglich sind. Ich sage
bewußt: mit EDV-Unterstützung. Die entscheidenden Fragen muß immer
noch der Sprachwissenschaftler stellen und aufgrund des
Befundes beantworten. In diesem Sinne ist der Computer
nicht mehr und nicht weniger als ein wohlorganisierter
Zettelkasten - des Philologen liebstes Kind -, der es aber
erlaubt, überaus große Textmengen
in überschaubarer Zeit zu bearbeiten. Die EDV
gestattet eben breit angelegte Analysen, die manuell nicht
mehr zu bewältigen wären. Mit anderen Worten: Wir
können jetzt Fragen stellen, die wir bislang aus
arbeitstechnischen Gründen nicht stellen konnten. Unser
Bild von den früheren Sprachstufen wird sich dadurch um
einiges ändern, vor allem, es wird dem Gegenstand
angemessener werden.
Das wachsende Knowhow im Umgang mit der Technik,
Erfahrungen mit der Schulung von wissenschaftlichen
Mitarbeitern und studentischen Hilfskräften im Bereich der
Forschung, Seminare über die Anwendung von EDV-Verfahren
in der Philologie, dies alles regte die Konzeption eines
Aufbaustudiengangs an. Betriebsbesichtigungen und
Gespräche mit EDV-Praktikern in den Betrieben vermittelten
zusätzlich praxisbezogene Vorstellungen davon, was die
Chancen eines Philologen auf diesem Arbeitsmarkt
verbessern könnte. Schließlich konnte 1985 der
Aufbaustudiengang zunächst probeweise für zwei Jahre,
seit dem Wintersemester 1987/88 auf Dauer installiert werden.
Voraussetzung für die Einschreibung ist ein erster
Hochschulabschluß in einem philologischen Fach
(möglichst mit sprachwissenschaftlichem Schwerpunkt).
Zur Abschlußprüfung wird zugelassen, wer alle
erforderlichen Lehrveranstaltungen erfolgreich absolviert,
d.h. die einschlägigen Klausuren bestanden bzw. in den
Praktika die notwendige Anzahl von Übungsaufgaben richtig
gelöst hat. Der erfolgreiche Abschluß des Aufbaustudiums
wird durch ein Zeugnis bestätigt, aus dem die besuchten
Lehrveranstaltungen und die Note der vierzigminütigen,
mündlichen Abschlußprüfung hervorgehen.
Auf die Kooperation mit anderen Fächern wird besonderes
Gewicht gelegt. Die jeweils zuständigen Institute der
Universität vermitteln Kenntnisse in Programmiersprachen
bzw. Programmiertechnik (zwei Seminare),
betriebswirtschaftliche Grundbegriffe (ein Seminar) und
EDV-Englisch (ein Seminar). Mit dem Institut für
Informatik ist zudem vereinbart, daß Teilnehmer des
Aufbaustudiums an für sie besonders geeigneten
Veranstaltungen teilnehmen können.
Insgesamt kommt so ein Wochenpensum allein an
Pflichtveranstaltungen von 28 Stunden pro Semester
zusammen, das durch ein mindestens vierwöchiges
Betriebspraktikum in den Semesterferien ergänzt wird.
Die Belastung für die Teilnehmer am Aufbaustudium ist
damit erheblich. Freilich sind das keine Studienanfänger
mehr, sondern Absolventen, noch dazu hoch motivierte,
denen dieses Pensum, wie die Praxis zeigt, zuzumuten ist.
Das Spektrum von Haupt- und Nebenfächern der Teilnehmer
umfaßt praktisch das gesamte Studienangebot der
Philosophischen Fakultäten von Sinologie, Latein,
Archäologie über Germanistik, Anglistik, Romanistik
bis zu Psychologie, Pädagogik und Musikwissenschaft. Als
Studienabschluß überwog deutlich der Magistergrad
(20) gegenüber Staatsexamen (16), Promotion (1) und
sonstigen Abschlüssen (5).
Ermutigend für das Konzept des Aufbaustudiums erscheint
uns auch der Erfolg der Absolventen bei der Stellensuche.
In Zahlen: Von 30 Kursteilnehmern, deren Verbleib wir
kennen, haben acht einen Arbeitsplatz in Industrie und
Verwaltung außerhalb traditionell philologischer Bereiche
gefunden, sechs sind im EDV-Sektor (Hersteller, Vertrieb,
Schulung) tätig, je zwei in Verlagen bzw. privaten
Fortbildungseinrichtungen, sechs arbeiten in verschiedenen
Forschungsprojekten an Universitäten, fünf streben
nach dem Studienabschluß - z.T. mit Stipendien - noch die
Promotion an, eine Absolventin ist anderweitig beschäftigt.
Wie sich die Aufnahme der Absolventen auf dem Stellenmarkt
in der Zukunft entwickelt, bleibt abzuwarten. Als
positives Indiz erscheint uns zumindest die langsam
wachsende Bereitschaft von Betrieben, Praktikumsplätze
auch für Philologen aus dem Aufbaustudium zur
Verfügung zu stellen.
Werner Wegstein (Institut für Deutsche Philologie, Würzburg)
Das Würzburger Aufbaustudium "Linguistische Informations- und Textverarbeitung"
Seit dem Wintersemester 1985/86 wird an der
Philosophischen Fakultät II der Universität
Würzburg Absolventen philologischer Fächer die Möglichkeit geboten,
sich im Aufbaustudiengang "Linguistische Informations- und
Textverarbeitung" mit Problemen der Verarbeitung von
Sprache(n) auf Großrechneranlagen und Mikrorechnern
vertraut zu machen. Dahinter versteckt sich keine
kaschierte Umschulung in Richtung Datenverarbeitung, gar noch
mit dem Hintergedanken, es wäre dafür eigentlich am
besten, die bisher studierten Fächer rasch zu vergessen.
Im Gegenteil: durch das Aufbaustudium soll den Philologen
die Fähigkeit vermittelt werden, auf ihrem Fachgebiet die
Werkzeuge der elektronischen Datenverarbeitung in der
Informations- und Textverarbeitung optimal einsetzen zu
können. Diese zusätzliche Qualifikation soll es ihnen
erleichtern, sich mit ihren Fachkenntnissen als Philologen
neue Arbeitsfelder zu erschließen in Industrie und
Verwaltung, im Bereich von Dokumentation, Medien, Schulung
und Ausbildung, aber auch in traditionell philologischen
Gebieten wie Verlagswesen, Archiven, Bibliotheken.
Vorgeschichte
Anstoß zur Einrichtung eines Aufbaustudiums mit dieser
Thematik war in Würzburg die philologische Forschung: Vor
gut zwölf Jahren wurde am Institut für deutsche
Philologie, in der 1974 gegründeten Forschergruppe "Prosa
des deutschen Mittelalters", damit begonnen, EDV-gestützte
Verfahren zur Edition mittelalterlicher Texte einzusetzen.
Die Programme hierfür, das Tübinger System von
Textverarbeitungsprogrammen TUSTEP, stellte
dankenswerterweise die Abteilung für Literarische und
Dokumentarische Datenverarbeitung der Universität
Tübingen, namentlich Professor Dr. Wilhelm Ott, zur
Verfügung. Auf der Hardware-Seite half das Würzburger
Universitätsrechenzentrum gerade in den schwierigen
Anfängen den sogenannten "Nichtnumerikern", elektronischen
Habenichtsen mit ungewöhnlichen Anforderungen und Vorstellungen.
Studienverlauf
Das Ausbildungsprogramm ist sehr bewußt auf zwei Semester
komprimiert: die oft beklagte lange Studiendauer der
Philologen soll nicht mehr als unbedingt nötig ausgedehnt
werden, stellt doch für Wirtschaftsunternehmen das
Lebensalter von 30 Jahren eine Art "magische Grenze" für
die Einstellung von Berufsanfängern dar, die es möglichst
weit zu unterbieten gilt. Andererseits sind aus der Sicht
der Hochschulabsolventen zwei weitere Semester zeitlich
das gerade noch akzeptable Maximum, für das man sich nach
dem Examen noch einmal zu engagieren bereit ist und das
man sich auch finanziell noch zutraut.
Studieninhalte
Die inhaltlichen Schwerpunkte des Aufbaustudiums liegen zu
gleichen Teilen auf dem Umgang mit Großrechnern und mit
Personal-Computern. Dabei geht es letztendlich nicht
darum, die Bedienung von irgendwelchen Betriebssystemen,
Textverarbeitungs- oder Datenbankprogrammen zu erlernen und
einzuüben, wenngleich es natürlich schon notwendig
ist, auch hierin über den Stand der Technik Bescheid zu
wissen. Vielmehr geht es um Anwendungskonzeptionen und um
Probleme, zu deren Lösung die philologische bzw.
sprachwissenschaftliche Kompetenz der Teilnehmer in
unterschiedlicher Weise - reflektierend, vermittelnd oder
produktiv - eingebracht werden soll. Die Studierenden
sollen dabei auch lernen, kommerzielle Software
hinsichtlich der Eignung für konkrete Zwecke zu bewerten,
auszuwählen, für die jeweilige System- und
Benutzerumgebung anzupassen und - falls notwendig -
weiterzuentwickeln. In diesen Rahmen gehören je zwei
Seminare für den Bereich Großrechner und PC jeweils
mit Praktikum, ein Seminar über Dokumentation und ein
Seminar zur Textverarbeitungsprogrammierung, ferner als
Wahlveranstaltung ein sehr elementarer Hardware-Kurs.
Erfahrungen
Die Erfahrungen nach drei Prüfungsjahrgängen mit insgesamt
42 Absolventen sind außerordentlich ermutigend. Nach etwa
sechs Wochen sind diejenigen, die sich mit dem
Aufbaustudium übernommen haben oder denen der Umgang mit
der Datenverarbeitung einfach nicht liegt, wieder
ausgeschieden. Wer darüberhinaus bleibt, arbeitet sich mit
philologischer Akribie und großem, durchaus kritischem
Engagement bis zur Abschlußprüfung durch.
(Die Kurzfassungen der Referate wurden von den Referenten zur Verf�gung gestellt.)
Zur
Übersicht über die bisherigen Kolloquien
tustep@zdv.uni-tuebingen.de - Stand: 27. August 2003